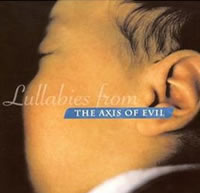Der
Mechanismus ist immer der gleiche. Jede Kriegsplanung steht vor dem
Problem, die eigene Bevölkerung von der Notwendigkeit des Angriffs
überzeugen zu müssen. Das ist alles andere als einfach,
und nicht umsonst sagt man, das erste Opfer eines Krieges sei immer
die Wahrheit.
Weil
die wahren Motive in der Regel entweder zu komplex oder zu fadenscheinig
sind, bedienen sich die Kriegstreiber zunächst des Mittels der
Herabwürdigung ihres Gegners. Sie teilen die Welt in Gut und
Schlecht und schaffen sich damit die moralische Legitimation für
Krieg, Mord und Folter. US-Präsident George W. Bush ist ein Meister
dieser Technik: Am 29.01. 2002 prägte er in einer Rede den Begriff
von der "Achse des Bösen", zu welcher er namentlich
Iran, Irak und Nordkorea zählte - "und ihre Verbündeten".
Heute
weiß man, dass der Irak-Krieg mit dieser Rede begann. Die Benennung
des "Bösen" lieferte den Amerikanern die nötige
Begründung für den Angriff. Das Böse muss beseitigt
werden - wer könnte diesem Ansinnen ernsthaft widersprechen wollen?
Wer
sich dieser plumpen Manipulation widersetzt, leistet wirkliche Friedensarbeit.
Geradezu subversiv erscheint es also, wenn dieser Tage eine CD veröffentlicht
wird, die den provokanten Titel "Lullabies from the axis of Evil"
- Wiegenlieder von der Achse des Bösen - trägt. Doch genau
die Offenlegung der schlichten Propaganda war auch das Ziel des norwegischen
Musikproduzenten Erik Hillestad, als er sich aufmachte, die
"Achse des Bösen" zu erkunden.
Nicht
auf die Suche nach Bomben oder Terroristen begab er sich, sondern
nach Sängerinnen. Und er wurde fündig: in Syrien, in Palästina,
im Irak, in Afghanistan und im Iran, in Kuba und Nordkorea. Überall
traf er, zum Teil unter abenteuerlichen Umständen, auf Frauen,
die ihm bereitwillig Wiegenlieder in ihrer Sprache vorsangen. Hillestad
nahm die überwiegend a cappella vorgetragenen Lieder auf und
kehrte schließlich nach Norwegen zurück, wo er die Bänder
gemeinsam mit dem Arrangeur und Komponisten Knut Reiersrud
bearbeitete. Reiersrud unterlegte die Stimmen der Frauen mit zurückhaltenden
Arrangements, die den Charakter der Melodien und des Gesangs unterstreichen
sollten.
Warum
ausgerechnet Wiegenlieder? Für Hillestad symbolisieren sie den
Beginn aller Kommunikation und der Beziehung zwischen Menschen: "Zwischen
Mutter und Kind, Vater und Kind". Sie seien Teil einer universellen
Kultur, und sie zeigten über alle Grenzen und Differenzen hinweg
starke Verbindungen. "Sowohl musikalisch als auch inhaltlich
gibt es ästhetische Gemeinsamkeiten", so Hillestad.
"Die Themen sind oft die gleichen, ebenso wie die musikalische
Struktur. Unterschiede in Tonart, Sprache, Metaphorik und Religion
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine Verbindung
zwischen den Kulturen der Erde gibt."